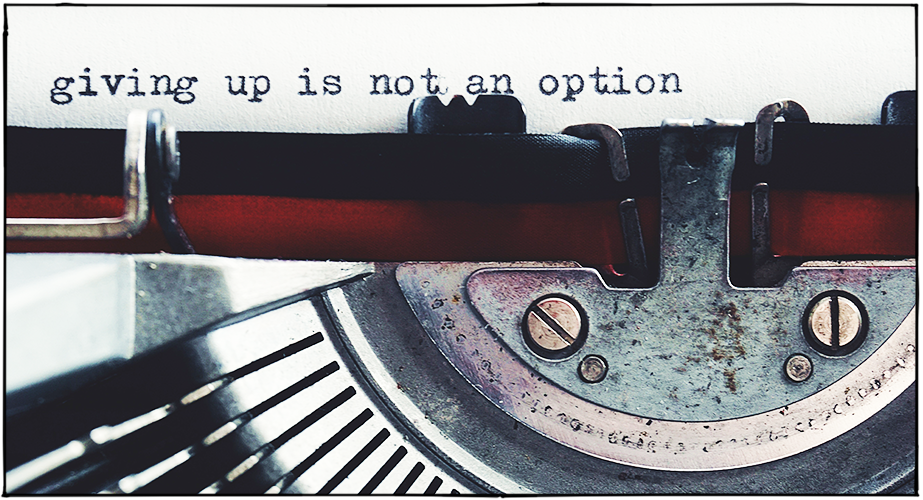Der Autorenlimbus
Ein Blog von Maximilian Wust
Einfach Autor
Fragt man Google danach, wie man Autor wird, scheint man gerade einer geworden zu sein.
Wer will, der kann schon morgen mit einem Fernstudium an einer von vielen (angeblich hoch renommierten und mehr als erfolgreichen) Schreibschulen beginnen und wer sich besonders talentiert wähnt, auch gleich sofort mit der Schreiberkarriere durchstarten: Alles, was man wissen muss, lernt man durch eine Handvoll Youtube-Tutorials; die Schreiber-Software Papyrus übernimmt scheinbar von selbst Kapitelstruktur und Timeline und dank den eBooks und diversen Leitfäden zum Self-publishing kann man sich auch die Suche nach einem Verlag sparen. Von den seltsam vielen Anzeigen – mehr noch als bei Horoskopen und Homöopathie – einmal abgesehen, scheint es keine große Kunst mehr zu sein, ein Autor zu werden.
Wer davon nicht sofort überzeugt ist, dem wird das Herz zudem mit Erfolgsgeschichten gewärmt, wie natürlich von J.K. Rowling, die als vermeintliche Arbeitslose mit Harry Potter den größten Fantasy-Zyklus aller Zeiten schrieb; Cormac McCarthy, der sich einfach mal, weil er sonst keinen Verlag kannte, bei Randomhouse bewarb und auch sofort genommen wurde, sowie von Poppy J. Anderson und Hanni Münzer, den Königinnen der deutschen Selbstverlegerszene, die ihre Romane scheinbar planlos runtertippten, selbst veröffentlichten und jetzt davon leben – die lebenslange Bewunderung ihrer Leser inbegriffen. Einzig Andy Weir, dessen selbstverlegter Debütroman „Der Marsianer“ sogar von Hollywood und mit erstklassiger Besetzung verfilmt wurde, wird erst unerwartet spät erwähnt. Stattdessen aber warten selbstverständlich auch die typischen Geheimtipps, die auf der ersten Googleseite sicher vieles sind, jedoch nicht geheim.
Fragt man Google dagegen, wie man Profisportler werden könnte, wird der Berufswunsch nur kaum und ernüchternd angesprochen. Nach nur ein paar Einträgen folgt eine Analyse über Profisportler und Alkoholprobleme. Werbeanzeigen jeder Art bleiben aus. Der Boulevard aus Werbung und Versprechen scheint den Autoren und Youtubern vorbehalten zu sein.
In der Vorhölle
Viele Menschen – vermutlich mehr, als es zugeben würden – träumen vom Autorendasein und wie schon so oft wollen andere an diesen Träumen verdienen. Und das wohl mit Erfolg, wenn man betrachtet, wie deutschlandweit Schreiberschulen aus dem Boden schießen und sich sogar Werbung an Bushaltestellen und Bahnhöfen leisten können.
Die Realität ist wie so oft entzaubernd: Kaum ein einziger Blog warnt vor den vernichtend geringen Chancen auf Erfolg oder schildert die Schicksale der vielen Gescheiterten – wie den Hunderten, die jedes Semester besagte Schreibschulen absolvieren und trotzdem keinen einzigen Wettbewerb gewinnen. Die Tatsache, dass beinah jeder Selbstverleger scheitert, muss man erst explizit suchen, ebenso wie die Statistik, dass nur etwa 0,04% aller über einen Verlag publizierten Autoren auch davon leben können.
Die deutsche Verlags- und Autorenszene ist weniger ein Wunderland als ein Friedhof. Allein nach nur einer Stunde der Recherche zähle ich über einhundert Erstlingswerke, von denen vermutlich einmal jemand glaubte, dass sie seine Autorenkarriere starten würden, bevor sie stattdessen zu deren Grabstein wurden. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Arbeitsstunden flossen allein in den letzten fünf Jahren in all diese Träume, die oft schon seit der Grundschule verfolgt, aber doch nie wahr werden.
Dennoch erzählen Selbstverleger und Indie-Autoren in über zweihundert Blogs, auf Youtube und in Facebook-Gruppen beinah esoterisch von ihren Erfolgen und wie erfüllt ihr Leben nun ist, während sogar die eher positiv-denkende SPIEGEL-Kolumnistin Sybille Berg selbstverlegte Werke als Autounfälle bezeichnet und Verlagsagenturen angeblich jeden Bewerber ausfiltern, dessen Lebenslauf einen selbstverlegten Roman beinhaltet.
***
Wer etwas Geduld mitbringt und sich durch die, meist verlassenen, Autorenforen kämpft oder die Beiträge in Schreibergruppen auf Facebook verfolgt, entdeckt bald ein noch dunkleres Bild als einfach nur Niederlagen: Viel mehr existiert dort eine ganze Subkultur aus Ewigscheiternden, die trotz aller Mühen, Workshops und Tutorials vor den Pforten des Berufsautorenhimmels feststecken und oft jahrelang auf einen Durchbruch hoffen, bevor sie schließlich aufgeben.
Da sind beispielsweise die Selbstverleger, die auch genauso selbst Lesungen organisieren und die Werbetrommel rühren müssen; die Sturen, deren Romane von über einhundert Verlagen und Agenturen abgelehnt wurden, die perfektionistischen Abbrecher, deren Festplatte nur so von literarischen Baustellen strotzt und viele andere Archetypen und Individualisten.
Sie alle warten auf den Durchbruch, der vielleicht nie kommen wird. Aufzugeben und damit zuzugeben, „dass man Jahre seines Lebens vergeudetet und Chancen, Freundschaften oder sogar Beziehungen umsonst geopfert hat, das macht halt keiner gern“, wie mir ein schon lange strebender Autor treffend erklärt. Gleichzeitig kämpfen sie gegen die immer gleiche Wahrnehmung von außen, wo sie als Verzweifelte gelten, die über jede Schmerzgrenze hinaus einfach nicht verstehen wollen, dass ihr Talent nicht zum Autoren genügt.
Um aus dieser Welt, diesem Autorenlimbus, zu erzählen, habe ich in den letzten neun Monaten über dreißig „Ewigscheiternde“ interviewt und die sechs am meisten repräsentativen Geschichten zusammengefasst – nicht, um Träume zu zerstören, sondern um von den Risiken, den Kämpfen und Schmerzen zu erzählen, die man auf dem Weg zum Autoren ertragen muss.
Alle nun interviewten Personen haben den Artikel über sich selbst gelesen und zugestimmt, dass er so veröffentlicht werden darf. Alle Namen sind geändert, für die Richtigkeit ihrer Geschichten kann ich nicht garantieren. Ihre Bilder entsprechen zudem mehr meiner Interpretation und ihren Wünschen als ihren realen Gesichtern.
 Die Berufsfreundin
Die Berufsfreundin
Wenn sie jemand nach ihrem Beruf fragt, antwortet Antonina (29 Jahre alt) niemals, sie wäre Autorin. Das würde man ihr nicht abnehmen. Oft, wenn sie nicht darüber sprechen will, gibt sie einfach an, als Sekretärin zu arbeiten. Glaubt sie dagegen, einer Person gegenüber ehrlich sein zu dürfen, so sagt sie scherzhaft, vom Beruf Freundin zu sein und meint das durchaus ernst: Während sie etwa acht Stunden pro Woche als Bürokauffrau in einer Spedition arbeitet, um durch die Sozialversicherungen geschützt zu sein und sich nicht mit dem Arbeitsamt herumschlagen zu müssen, bezahlt ihr Freund Norbert nicht nur seinen, sondern auch ihren Anteil der Lebenskosten, wie auch den alljährlichen, gemeinsamen Urlaub. Als IT-Systemadministrator verdient er genug für beide.
Antonina, die sich mir gegenüber scharfsinnig, intelligent, wie leider auch desillusioniert zeigt, gehört zu einer Subspezies der aufstrebenden Autorinnen, der Berufsfreundin, von denen mehr existieren sollen, als ich vermutlich glaube (wobei sie hierbei keine Zahlen nennt). „Möchtegern-Autoren leben von Hartz IV, Möchtegern-Autorinnen von ihrem Kerl“, erklärt sie im leicht sächsischen Dialekt.
Stolz darauf ist sie jedoch nicht. Sie lasse sich aushalten, sei noch der geringste aller Vorwürfe und feindselige Kommentare, wie z.B. dass der Sex mit ihr wirklich phänomenal sein muss, wenn sie sonst schon nichts zur Beziehung beiträgt, wären sogar schon von guten Freunden in den Raum geworfen worden – als Scherz verkleidet, so dass man es jederzeit zurücknehmen kann. Im Gegensatz zu den meisten Berufsfreundinnen und „yoga moms“ leide Antonina allerdings tatsächlich unter ihrem Gewissen. Vorwürfe dieser Art nimmt sie sich zu Herzen.
Wo andere arbeiten gehen oder sich um die Kinder kümmern, schreibt sie. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit Norbert räumt sie lediglich das Geschirr in die Spülmaschine, bevor sie sich an ihren Laptop setzt und tippt. Sie streamt sich nicht durch Netflix, noch arbeitet sie die gemeinsame Steam-Bibliothek ab, sondern verfasst ihre Romane und das den ganzen Tag lang. Die einzige Unterbrechung stellt ihre Mittagspause dar, die aus selten mehr als einer Dose Ravioli, einer Fertigpizza oder anderem Convenience Food besteht, bis Norbert wieder nach Hause kommt. Kinder habe das Paar keine, auch keine geplant und den Haushalt, die Wäsche und Einkäufe erledigen sie nur gemeinsam.
Norbert scheint das wenig zu stören, ob er allerdings wirklich an ihren Traum glaubt oder das jemals getan hat, kann Antonina nicht sagen, ebenso wenig, ob er noch lange ihre Startbahn sein wird. Seine Freunde halten ihn für einen Idioten oder für sehr verzweifelt. Er hatte es schließlich schon immer schwer gehabt, eine Freundin zu finden.
Schreiben ist für Antonina wie Atemluft. Sie schreibt gern und gerne provokant. Dabei will sie ihren Lesern nicht einfach bloß ein seichtes Entertainment-Programm für die S-Bahn-Fahrt bieten, sondern sie schockieren, in zerrissene Seelen blicken und vielleicht sogar mit einer Narbe zurücklassen. „Woran erinnert wir uns mehr?“, fragt sie rein rhetorisch. „An eine tolle Geburtstagsfeier oder als wir von unserer besten Freundin verarscht wurden? An Schönes oder an Schreckliches?“
Ihre Romane, eigentlich Fantasy-Abenteuergeschichten, erzählen oft von physischer und psychischer Gewalt, von Erniedrigung und Sadismus und wie die Opfer jener Taten danach wieder zu sich selbst oder sogar Gefallen daran finden. Nicht selten werden sie zu Tätern. Antoninas Welten zeigen sich daher meist düster und unangenehm sozialdarwinistisch: Die Stärkeren bedienen sich der Schwächeren und wer etwas möchte, ob nun Essen, eine Frau oder Land, der sollte auch die Macht haben, es sich einfach nehmen zu können. So müssen sich in einem ihrer Settings Vampire nicht mehr verstecken. Sie herrschen längst offen über die Menschheit, die nicht nur aus Nahrungsgründen, sondern auch zum reinen Vergnügen jagen.
Zum Thema Schreiber und Schreiberei offenbart mir Antonina ein farbenfrohes Bild: Autoren sind aus ihrer Sicht keine weltenschaffenden Götter, sondern Filmstudios: Nicht nur, dass sie ein Universum erschaffen, es mit Regeln füllen und alle Bewohner nach diesen arbeiten und wirken lassen; sie stricken darin politische Spiele, formulieren Fraktionen und starten Bewegungen und Gegenbewegungen; als Soziologen diskutieren sie (vor allem mit sich selbst), wer in diesem Gefüge nach oben kommt und wer ganz unten Diskriminierung und Anfeindung erfährt; als Psychologen erforschen sie die Ängste und Hoffnungen der einzelnen Individuen, bevor sie schließlich zu Bühnenbildnern, Kameramännern, Regisseuren und Schauspielern werden, die dem geneigten Leser glaubwürdige, emotional ergreifende Dialoge vor interessanter Kulisse präsentieren müssen. Und das alles nur in gedruckten Worten.
Antonina verweilt noch lange in ihren Ansichten und Gedanken, ich höre interessiert zu, bevor sie schlagartig das Thema wechselt: Praktisch niemanden interessiert, was sie über die Schriftstellerei denkt, noch was sie eigentlich schreibt – ob nun ihre Mutter, die nie mehr als vier bis fünf Seiten in ihre Romane hineinliest, ihre Freunde oder Norbert, dem sie dennoch über alle Maßen dankbar ist.
***
Bisher schrieb Antonina fünf Fantasy-Romane, jedes Jahr einen, von denen jedoch keiner von einem Verlag angenommen wurde. Sie nahm an über fünfzehn Schreibwettbewerben teil, schaffte es jedoch nicht ein einziges Mal in die oberen drei Plätze.
 Der Zufriedene
Der Zufriedene
Natürlich wäre er gern Berufsautor, sagt er und warnt: „Reaper von hinten!“ Manuel, 36 Jahre alt, wollte sich weder im Skype treffen, noch sich per Chat interviewen lassen. Persönlich wäre ihm am liebsten gewesen, aber da ich nicht eben nach Brandenburg fahren kann, kam ihm eine Idee im Sinne der gemeinsamen Interessen. Und so spielen wir nun Overwatch; ich in der Rolle des Reinhardt, ein Ritter in Maschinenrüstung und er schwebt als Pharah, eine ägyptische Schönheit mit Raketenrucksack, über das Schlachtfeld. Wir amüsieren uns. Und reden.
Klar wäre er gern Berufsautor, wiederholt er, nachdem besagter Reaper vertrieben wurde. Aber dass er es jetzt im Moment nicht ist, ist auch okay. Er kommt gut durch. Wo andere aufstrebende Schriftsteller finanziell straucheln, sich vom Partner abhängig machen oder in Verzicht üben müssen, leidet er keine Not. Als Programmierer mit über zehn Jahren Berufserfahrung arbeitet er lediglich zweieinhalb Tage pro Woche und verdient dennoch mehr als viele Grafiker in Vollzeit. „Und da ist auch noch was von meinen Eltern“, fügt er an, beantwortet mir aber nicht, was er damit meint.
In der Zeit, die er nicht arbeitet oder mit Videospielen verbringt, da schreibt er – vornehmlich Military-Science-fiction, über Kriege und Schlachten im Weltraum, aber auch Geschichten und Romanversuche in einer ausgearbeiteten, sympathisch bizarren Welt, die vor allem auf Musik und Klängen basiert – wo Gefechte mit Trompeten geführt und Rap-Verse zu tödlichen Klingen werden können. In dieser Welt (die ich hier nicht namentlich nennen kann, weil man sie sonst einfach googeln könnte) verarbeitet Manuel auch die Gespräche mit seiner Mutter, einer Musiklehrerin, die schier alles über Musik und Klang verstehen zu scheint, aber dennoch nie ein eigenes Talent dafür entwickelt hat. Dabei ist ihm sehr wichtig, die begonnenen Projekte auch abzuschließen. Ganz gleich, wie schlecht oder wie unerträglich sie am Ende sein mögen, Manuel mag es nicht, sie halbfertig zurückzulassen und beendet sie daher meist auch. Darum beneide ich ihn.
Große Pläne für die Zukunft hegt er jedoch keine. Vielleicht lernt er sowas wie eine bessere Hälfte kennen, geht zurück in die Vollzeit und gründet eine Familie. Vielleicht wird er doch eines Tages Schriftsteller. Wichtig scheint es ihm jedenfalls nicht zu sein. Er kenne zu viele Nie-Autoren (wie er sie nennt), die jahrelang schrieben, sich bei Verlagen bewarben, an Wettbewerben teilnahmen, dann als Selbstverleger versuchten, nur um wieder und wieder feststellen zu dürfen, dass es in Deutschland zu viele Bücher und zu wenig Leser gibt.
Für die meisten aufstrebenden Autoren hat er nicht viel übrig. So geht es ihnen aus seiner Sicht nur selten darum, ein neues Universum zu erforschen oder eine neue Geschichte zu entdecken, sondern um reine Selbstdarstellung. Wo vor allem jüngere Schreiber Tagträume von unbekannten Welten erleben, träumen diese Leute insgeheim von Signierstunden, Fan-Gemeinden, Interviews und generell von einem Leben im Mittelpunkt. Ihre – leider bestenfalls mittelmäßigen – Texte seien schon jetzt genial, nur halt noch nicht entdeckt. Riesen-Ego, null Selbstreflexion. So beschreibt Manuel missgünstig die Bewohner des Autorenlimbus’. Ganz Unrecht hat er nicht. Ich war vor etwa fünfzehn Jahren nicht viel anders.
Zum Schluss seiner Analyse gibt Manuel allerdings zu, dass das vielleicht auch nur ein Selbstschutzmechanismus ist. Indem er nicht hart daran arbeitet, ein vollwertiger Schriftsteller zu werden, kann es ihn auch nicht so sehr verletzen, wenn er am Ende daran scheitert. Natürlich würde er gerne eine eigene Saga schreiben und über die Theorien seiner Fans schmunzeln. Natürlich würde er gern eine Welt erschaffen, in der 16-jährige Bücherwürmer ihre Fan-fictions und Mary-Sue-Charaktere ansiedeln. Aber wieso sollte ihm gelingen, woran sich sogar schon studierte Journalisten mit zwanzig Jahren Berufserfahrung die Zähne ausgebissen haben?
***
Manuel hat bisher vier Romane und über fünfzig Kurzgeschichten geschrieben. Damit bewarb er sich – den Tipps von Harald Eschbach folgend – ausschließlich bei Agenturen und Kleinverlagen, jedoch auch dort ohne Erfolg.
 Die Selbstverlegermarketingmanagerin
Die Selbstverlegermarketingmanagerin
Sonja, 32 Jahre alt, war während ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büro und Kommunikation langweilig. Anstatt es allerdings ihren Mit-Azubinen gleichzutun und auf Lokalisten zu surfen, begann sie, Kurzgeschichten über Drachen zu schreiben. Ob nun Drachenreiter, Drachentöter, Drachenblütige oder Drachensucher – ihre Drachenzeit beschreibt es einer Epiphanie gleich, als sie mit 18 Jahren die Fähigkeit entdeckte, Geschichten nicht nur zu lesen, sondern auch selbst schreiben zu können. Naiv wie sie war, so erzählt sie mir kichernd, bewarb sie sich noch während ihrer Ausbildung als Autorin beim Heyne-Verlag – so als wäre das ein ganz normaler Job, auf den man sich mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis bewerben kann. Heyne antwortete angeblich sogar, wenn auch nur mit einer wortkargen Absage.
Heute ist sie alles selbst: Die Autorin, die Layouterin, die Lektorin, der Verlag und das Marketing – und das neben ihrem Vollzeitjob und einer Beziehung, die sie als „mehr so eine Art Affäre“ beschreibt. Sonja übernimmt eigenhändig alle Stationen des Verlegens: Sie schreibt nicht nur ihre Romane, meist im Bereich Vampire und Mystery, sondern redigiert sie auch mit ihrer besten Freundin, layoutet sie in InDesign und gibt sie eigenhändig in den Druck. Nur das Cover lässt sie von einem Grafiker ihres Vertrauens anfertigen. Nach der Produktion organisiert sie selbst die Lesungen und das in einem Radius von über zweihundert Kilometern. Mindestens ein, oft zwei Wochenenden pro Monat verbringt sie im Auto oder in Bücherstuben, wo sie vor kleinem Publikum Passagen aus ihren neuesten Werken vorträgt. Inzwischen hat sie darin echte Routine. Sie weiß, wie man skeptische Buchhändler überzeugt, die Lokalpresse auf einen Besuch beschwatzt und die Leser begeistert – jedoch leider auch, dass das längst nicht immer funktioniert. Sie kennt die Kommentare der Büchereien, wenn sie davon schwärmen, dass letzten Monat dieser oder jener berühmte Autor hier gewesen wäre und für echten Platzmangel in der Stube gesorgt hätte. Was übersetzt bedeutet: Das war ein lukrativer Besuch. Deiner war Zeitverschwendung.
Auf die Frage, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, ohne vom Stress begraben zu werden, wird sie vorsichtig. Schon öfters habe sie das Gefühl gehabt, einem Burnout nahe zu sein, konnte sich aber dann doch wieder aufraffen. Als Zeichner, Grafiker und Schreiber gleichzeitig kenne ich ihre Art Stress. Ich frage sie, ob es sich wenigstens zahlentechnisch lohnt, was sie zögernd beantwortet. Die verkauften Romane deckten bisher nicht einmal die Produktionskosten, noch weniger den zeitlichen Aufwand. Das ist halt Durchbruchsarbeit. So nennt Sonja alle Investitionen und Tätigkeiten rund um ihre Passion; auf das ihr irgendwann der langersehnte Durchbruch gelingt.
Hinter der Schriftstellerei verbirgt sich für sie dagegen wenig Philosophie. Ihre Plots steckt sie bestenfalls in Stichpunkten ab, meist aber beginnt sie einfach loszuschreiben und lässt sich selbst davon überraschen, wohin die Geschichte geht und wem ihre jeweilige Protagonistin dabei begegnet. Wer der Böse ist und wie die ganze Sache ausgeht, das muss Sonja oft erst selbst herausfinden, so wie später einmal der Leser. Wichtig ist nur, dass es sich gut anfühlt. Hierbei kann ich nicht sagen, ob ich sie für naiv oder weise halte.
Erst am Ende unseres Gesprächs bemerkt sie, dass ihr Kaffee kalt geworden ist. Sie muss lachen und dann auch sofort weiter. Ihr Zeitplan ist voll und ihr Ziel klar gesetzt: Berufsautorin werden, vom Schreiben leben können. Auf die Tatsache, dass ich in diesem Artikel keine Namen veröffentliche, reagiert sie dagegen schroff. Auf diese Art helfe mein Blog niemandem, außer mir selbst.
***
Sonja hat sechs Bücher veröffentlicht und in ihrem ganzen Leben, so sagt sie, lediglich drei Kurzgeschichten geschrieben. Bei einem Verlag bewarb sie sich – neben dem ersten, sympathisch-tapsigen Versuch – nur mit dem ersten Werk.
 Der Kritiker
Der Kritiker
Karl, 34 Jahre alt, ist der geborene Kritiker. Er motzt nicht einfach nur gern, sondern zersetzt mit fast chirurgischer Professionalität und anerkennenswerter Scharfsinnigkeit jede Geschichte, die in die Wahrnehmungsreichweite seines Verstandes gerät. Und darin ist er gut: Ich komme nicht umhin, seinen Analysen zuzustimmen, wo z.B. Charaktere unlogisch reagierten, wo eine Situation zu einfach gelöst wird oder ein Ende zu schwach ausfällt. Als ich hierbei die Serie LOST erwähne, das Musterbeispiels des sogenannten Chris-Carter-Effekts (in welchem ein riesiges Mysterium aufgebaut wird, nur um am Ende unkreativ und unbefriedigend aufgelöst zu werden), verstehen wir uns gut. Karl ist hervorragend informiert und belesen, was seinem Wunsch nach dekonstruktiver Kritik sehr entgegen kommt.
Doch je mehr Medien von ihm minutiös seziert und für ungenügend erklärt werden, umso mehr glaube ich, dass er es vor allem tut, um sich überlegen zu fühlen. Als hätte er die Lüge durchschaut, die jeder lebt. Würde er tindern, so würde er vermutlich seinem ersten Date erklären, was sie an ihrem Profil verbessern könnte. Als sich das Interview zu einem Dialog entwickelt und ich auch meine Meinung zum Thema Geld in Romanen äußere, stoppt er mich. Er wäre es, um den dieses Gespräch geht und daher seien meine Gedanken überflüssig, belehrt er mich und spricht weiter. Und ich merke, dass es nicht einfach wird, ihn objektiv und ohne eigene Meinung zu beschreiben.
So kritisch Karl jedoch mit seiner Umwelt umgeht, so ist er auch zu sich selbst. Keines seiner Werke hat in seinen Augen ein gutes oder auch nur brauchbares, veröffentlichungswürdiges Niveau erreicht, weshalb er sie meist schon nach der ersten Hälfte verwirft. Sie sind einfach nicht gut genug. Manchmal weint er sogar, beichtet er mir, wenn ihm bewusst wird, dass er den Karren storytechnisch wieder in den Dreck gefahren hat – eine Redewendung, die er so von Höhlenweltschöpfer Harald Evers übernahm, dessen Bücher er für „unter dem Niveau eines Groschenromans“ hält, aber dennoch alle gelesen hat. Meist hadert er daraufhin zwei oder drei Tage mit sich, bevor er mit einer nächsten, ohnehin viel besseren Idee beginnt. Inzwischen weiß er jedoch, dass es damit genauso enden wird. Noch bevor ich jedoch die Frage stellen kann, warum er nicht einfach mit dem Karren im Matsch weitermachen will, wo doch genau dies der Stoff sein kann, aus dem gute Geschichten entstehen, höre ich ein Knacken, gefolgt von einem Zischen. Er hat sich ein Monster Energy aufgemacht und mich aus meinem Konzept gerissen. Wir skypen. Ohne Webcam.
Karl lebt noch bei seiner Mutter, mit der er nach eigener Aussage ein alles andere als gutes Verhältnis pflegt. Sie scheint ihn nicht für einen Versager zu halten, sich aber auch nicht wirklich für ihn zu interessieren. In seinen Zwanzigern wollte sie ihn noch zum Abschluss eines Studiums bewegen oder „nach draußen“ scheuchen, um eine Frau kennenzulernen. Als er Dreißig wurde, gab sie das jedoch auf und ihn gleich mit dazu. Vorsichtig frage ich nach einer Lebenspartnerin, was er mit Gleichgültigkeit verneint.
Ich versuche das Thema auf seine Geschichten und Schreibtechniken zu lenken und komme doch nur wieder bei systematischer Kritik an. Wo andere von ihren Charakteren oder Welten schwärmten, erklärt er mir, was George R.R. Martin und Tolkien an ihren falsch gemacht haben. Politische Verhältnisse hätten sich nicht so entwickeln können, Sauron wäre niemals so weit gekommen, kein halbwegs kluger General würde in solche Schlachten ziehen. Würde man ihm die Erde im Jahr 2019 vorsetzen, würde er sie als unrealistisch, profan und für ihre mangelnde Handlungstiefe kritisieren.
Schreiben jedoch kann er, mit großem Talent. Das einzige Werk, das er mir zum Lesen überlässt, die ersten zwei Kapitel eines Fantasyromans, sind außerordentlich gut, sehr präzise und unerwartet gefühlvoll geschrieben und erzählen von einer Welt der Elfen, die von Rassismus und drakonischen Klassenstrukturen geprägt ist. Als der junge Protagonist gerade in die politischen Ränkespielchen seines Standes eingewiesen werden soll, erscheinen in einer Ruinenstadt Menschen, die eigentlich als ausgestorben galten und vor allem für eines bekannt sind: ganze Welten mit ihren überlegenen Waffen und Dampfmaschinen auszuplündern und magisch zu ruinieren. Das gefällt mir – nicht nur die Geschichte, sondern auch, wie er oft mit nur einem einzigen Satz Orte präzise beschreibt oder Hintergrundwissen zu allen möglichen Themen tiefgehend vermittelt. Auch wenn sich mir die Handlung noch nicht vollständig eröffnet hat, wäre es definitiv ein Werk, das ich weiterlesen würde. Und gerade von jemandem wie Karl erwarte ich mehr, als eine einfache Schwarz-Weiß-Malerei über die Bösartigkeit der Menschen gegen die ach so wunderbare Balance der Natur. Herausfinden werde ich es leider nicht. Karl hat den Roman schon vor Jahren abgebrochen; nach den schon erwähnten, ersten beiden Kapiteln.
Das Thema Aufgeben scheint sein Leben zu beherrschen, ob es nun seine Autorenkarriere, seinen Beziehungswunsch oder sich selbst betrifft. Was ich sehr bedaure.
***
Karl hat „etwa“ um die fünfzig bis sechzig Romane begonnen. Können auch mehr sein. Fertiggestellt hat er nur zwei und obwohl er eines Tages Berufsautor sein möchte, schickte er bis heute (Dezember 2019) nur ein Manuskript an einen Verlag, das „natürlich abgelehnt wurde“.
 Die Machtlose
Die Machtlose
Damit ich ihr Interview zu meinen Bedingungen veröffentlichen darf, hat der Blog gleichgeschlechtlich zu sein. Genauso viele Interviews müssen von Frauen wie von Männern stammen und begonnen werden muss er mit einer Frau. Das ist ihre grundlegende Bedingung und deshalb ist dieser Blog nun auch so, wie er ist.
Marilena, 28 Jahre alt, weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Das lerne ich sofort. Video-Chat oder Whatsapp lehnt sie ab, daher treffen wir uns in einem Café in der Münchner Schrannenhalle. Sie spricht, ich tippe. Ihr Vertrauen genieße ich nicht, ebenso wenig gefiel ihr mein Roman, den sie in Rekordzeit durchlas und äußerst genau zu analysieren vermag. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ihr dieses Interview gut tut.
Marilena sieht sich als Feministin, als Rebellin und die Verlagsszene als Ganzes als eine patriachale Institution – und das betreffe nicht nur die Belletristik, sondern beinah jeden anderen Bereich, ob nun die GameStar, die Süddeutsche Zeitung oder Youtube. Das sei gar nicht einmal die Schuld der Männer selbst, sondern halt einfach historisch erwachsen, aber eben bis heute ein Hindernis. Dass man ihre Romane seit acht Jahren an allen Stellen ablehne, wie auch die vieler Freundinnen und Leidensgenossinnen, sei Teil dieser immer noch sehr archaischen Dynamik. Ich persönlich mag es nicht, wenn man allen Misserfolg auf einen Faktor, vornehmlich ein Geschlecht schiebt, behalte den Gedanken aber für mich.
Ihre Analysen über Frauen in der Literatur sind dagegen interessant: Zwar ließe man Frauen, auch in großen Verlagen, gern über ihren Alltag, über romantische Phantasien und Männer schreiben, würde ihnen aber immer noch die philosophische und journalistische Reife aberkennen, die man für zeitlose Bestsellerromane benötigt. „In der Literatur darf eine Frau am Kauf eines Ventilators oder an der Einrichtung ihres E-Mail-Kontos verzweifeln, ein Mann dagegen, der all das längst geschafft hat, sinniert über die vielschichtige Psyche eines Leuchtturmwächters auf den Hebriden“, erklärt sie zynisch. Natürlich gäbe es Ausnahmen, aber in der literarischen Welt, da wäre das Geschlechterbild noch einfach: Männer sind intellektuell, oft verkopft, manchmal schwermütig; Frauen dagegen lieben Farben, Kleidung und Rotwein und sind meist einfach gern naiv. Ein Bild, das leider auch zu oft von Frauen selbst so gewünscht und in Romanform gekauft wird – da ist Marilena ehrlich.
Ihrer Schreibertätigkeit geht sie im Feierabend nach und das außerordentlich strukturiert. Nach dem Essen und etwas Yoga schreibt oder recherchiert sie täglich zwei Stunden, am Samstag sind es bis zu sechs. Den Sonntag nimmt sie sich frei. Spontane Gedanken und Ideen, von denen jeder Kreative nur zu oft heimgesucht wird, schreibt sie in ein Notizbuch und überträgt sie später ins Digitale – mit Zuordnung, Kategorisierung und mehr. Ein 300-Seiten-starker Roman, erklärt sie hierbei, produziert gut und gerne noch einmal so viele Seiten an Notizen und Recherchematerial, die wiederum nach dem Schreiben sortiert werden. Alles hat in ihrem System eine feste Zeit. Diese Arbeitsweise hätte sie sich im Studium beigebracht und nur so habe sie sich durch die Kommunikationswissenschaften beißen und gleichzeitig jede Woche zwanzig Stunden arbeiten können.
Kein Verlag zeigte jedoch bisher an ihren Werken Interesse, auch keiner von den kleineren. Den Weg des Selbstverlages will sie nicht gehen. Verlage hätten einfach das, was man in der Wirtschaft angeblich ein Positioning nennt: Sie wissen nicht nur, was die Leser interessiert, sondern verfügen auch über ein ausgearbeitetes Vertriebsnetz, Händlerkontakte, Know-How, zielgerechtes Lektorat, Messeplätze, Cover-Designer und Marketingpläne. Gerade als Anfänger (und eigentlich auch als Profi) ist diese Maschinerie mehr als notwendig. Wenigstens, wenn man davon leben will.
Eigentlich wolle sie gar nicht nur von starken Frauen schreiben, erklärt Marilena zum Schluss, sondern von Menschen und ihrem Kampf gegen die Machtlosigkeit. Denn so habe sie sich ein Leben lang gefühlt: Machtlos. Im Autorenlimbus festzusitzen ist auch nur wieder eine Form von Machtlosigkeit. Dieser Schlusssatz beeindruckt mich mehr, als ich zugeben möchte.
***
Marilena schrieb bisher einen Jugendroman, den sie im Alter von 21 Jahren löschte und nach ihrem Studium noch einmal sechs weitere. Die Zahl ihrer Kurzgeschichten kennt sie nicht, vermutet aber zwischen vierzig bis fünfzig. Als 23-jährige gewann sie einen Anthologie-Schreibwettbewerb, wurde aber bis heute von jedem Verlag abgelehnt.
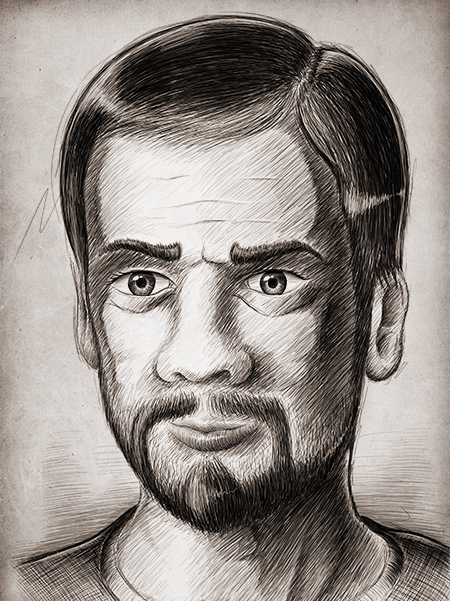 Der Existenzminimale
Der Existenzminimale
Ben ist „so Anfang 50“ und sucht derzeit nach einem neuen Staubsauger. Sein alter Vampyr begann vor einigen Tagen, seltsam zu riechen, bevor er schließlich für immer den Dienst quittierte. Dass Staubsauger überhaupt kaputtgehen können, hätte er nicht gedacht, scherzt er, bleibt aber zuversichtlich. Solche Kleinigkeiten sind meist schnell ersetzt. Irgendwer hat immer ein altes Gebrauchsgerät im Keller stehen – ob nun einen Staubsauber, einen Wasserkocher, eine Mikrowelle oder einen Fernseher, von dem er meist sofort sich für kleines Geld oder sogar umsonst trennt. Da spricht Ben aus Erfahrung.
Seit Jahren lebt der erfahrene Hobby-Autor am Existenzminimum. Für den Staat gilt er als Langzeitarbeitsloser, in Wirklichkeit aber arbeitet er selten weniger als sechzig Stunden pro Woche oder zehn Stunden am Tag. Von Montag bis Samstag konzipiert, recherchiert und schreibt er an seinen Romanen, die quer durch alle Genres gehen und auch ebenso alle Thematiken abdecken. „Man wächst mit jedem Roman“, erklärt er und meint damit nicht nur das Wissen, das man sich durch die Recherche aneignet, die sprachlichen Werkzeuge oder erzählerischen Bausteine, sondern auch Facetten der eigenen Seele, die sich offenbar erst zeigen wollten, als man z.B. eine Geschichte über einen Ornithologen schreibt, der von der Farbe Gelb besessen ist. In Foren und Facebook-Gruppen gibt er Tipps und Feedback oder holt sich selbiges für wiederum seine Werke. Ab und an hilft er Freunden am Computer, entfernt lästige Toolbars aus dem Browser und richtet Drucker oder das Internet ein, um sich ein kleines Taschengeld zu verdienen. Nur den Sonntag nimmt er sich frei. Da fährt er auf seinem alten Fahrrad durch die Stadt und liest in seinem Lieblingscafé den SPIEGEL, den es dort für ihn zusammen mit einem Cappuccino umsonst gibt.
Man gewöhnt sich an alles, erklärt er mir und meint damit sein Leben unter der Armutsgrenze. Er trifft sich nur selten mit Freunden, hatte schon seit vielen Jahren keine Gefährtin mehr, ist nie verreist und trägt größtenteils gebrauchte Kleidungsstücke, die ihn kauzig wirken lassen, wenn auch nicht stilvoll kauzig. Er ist halt durch und durch ein Kauz. Das weiß er. Aber man gewöhnt sich, wie gesagt, an alles.
Ben hat viel für einen Traum gegeben, der wahrscheinlich niemals in Erfüllung geht. Seine Arbeit ist längst zum Selbstzweck geworden. Jedes neue Manuskript schickt er inzwischen nur noch an Heyne und Bastei Lübbe und die nehmen es sowieso nicht. Was den Autorenlimbus angeht, versteht er sehr gut, warum es so viele gibt, die ein halbes Leben oder länger darin festsitzen. „Aufgeben und damit zugeben, dass man Jahre seines Lebens vergeudetet und Chancen, Freundschaften oder sogar Beziehungen umsonst geopfert hat, das macht halt keiner gern“, erklärt er. Das Leid und die erbrachten Oper müssen einem Zweck gedient haben.
In der Szene gilt er als ein alter Hase, der schon so ziemlich alles gesehen und erlebt hat – von Wunderkindern, die mit 13 besser schrieben, als so mancher preisgekrönter Bestsellerautor oder fünfzigjährigen Verzweifelten, die immer noch glauben, dass sie eines Tages durchstarten werden. Vor allem aber erzählt er von Neid und Verzweiflung, die sich mal leise und als Resignation, aber auch gern laut und als Hilferuf zeigen. 500 zu 1, lautet seine Statistik. Von 500, die es ernsthaft versuchen, schafft es vielleicht einer. Der Rest quält sich – zumindest online – oft noch Jahre vor den Mauern dieses verklärten Himmels ab, bevor sie schließlich verstummen und den nächsten nicht einmal als Warnung dienen. „Die waren halt einfach nicht gut genug; ganz im Gegensatz zu mir!“ ist aus seiner Sicht die wohl größte und gefährlichste Illusion eines Anfängerautors.
Neid, Missgunst und Arroganz seien dagegen das Los aller. Darüber spricht Ben sehr viel. Diese Attribute, so sagt er, sollen den Autorenlimbus heimlich, aber dennoch bis ins Mark beherrschen. In allen Schreiberforen, deutsch- wie englischsprachig, ebenso in den Facebook-Gruppen, aber auch außerhalb des Internets, im analogen Universum ist der Ton unter den angehenden Schreibern grundlegend freundlich. Man diskutiert, scherzt und streichelt sich hier und da für gute Ideen und interessante Zeilen gegenseitig den Bauch, jedoch stets mit einem heimlichen Überlegenheitsgedanken. „Fast jeder hält sich für besser als die meisten“, behauptet Ben und schließt auch uns beide dabei nicht aus. Doch das wäre schon in Ordnung – notwendiger Selbstschutz halt –, wenn es sich nicht laufend in die weit gefährlichere Missgunst ausufern würde: Sobald nämlich jemand weiterkommt, indem er z.B. einen Verleger findet oder einen Schreibwettbewerb gewinnt, beginnt die Szene angeblich ihr hässliches Gesicht zu zeigen. Dann wird viel über besagte „Gewinner“ gelästert, ihre Texte verrissen, peinliche Aussagen aus der Vergangenheit hervorgeholt. Ben sah Freundschaften zerbrechen, weil es einem „Mithäftling“ gelang, einen Roman zu veröffentlichen, der dann ohnehin nie so erfolgreich ist, dass er eine Berufsautorenkarriere gestartet hätte. Denn das sind die Bewohner der Autorenhölle: Häftlinge. Sie alle sitzen im selben Gefängnis und teilen dieselbe leere Hoffnung auf den Tag, an dem sie endlich frei sein werden. Wenn sich dann dieser Wunsch für einen Mithäftling erfüllen könnte, wenn nur einer auf einer besseren Matratze schläft, werden sie bitter. „Warum hat der es geschafft, ich aber nicht, wo ich doch viel besser bin“, so beschreibt Ben die Gedanken der „Zurückgelassenen“, bevor sie toxisch werden.
Er hat viel zu erzählen, nicht über das Wesen des Autorenlimbus’, sondern auch über die Philosophie des Schreibens, die Dekadenz der kleineren Autoren, von notwendigen Logiklücken und wie sich ein guter Roman zum „Schachspiel gegen sich selbst“ entwickeln kann. Doch je mehr er mir erklärt und schildert und so anregend viele seiner Gedanken auch sind, umso mehr wird mir bewusst, dass es unmöglich sein wird, seine über dreißig Jahre intensiver Erfahrung in einem Blog wie diesem zusammenzufassen. Die Idee, dass er sie doch aufschreiben könne, lehnt er ab. Er sieht sich nach wie vor als Schreiber und nicht als Schreiblehrer.
Am Ende unseres Gesprächs frage ich, ob er schon einmal darüber nachgedacht hat, einen Roman oder ein Sachbuch über dieses Thema zu schreiben, über einen Autor, der ein Leben lang einfach keiner wird. „Tausendmal“, antwortet er und lacht. Als er aufgelegt hat, verbleibe ich lange nachdenklich über meinen Notizen. Nicht nur, dass ich von seinen Erfahrungen und Analysen beeindruckt bin; ich beneide diesen Veteran der Durchbruchsarbeit um seine Hingabe und Ausdauer.
***
Ben hat insgesamt 41 Romane verfasst. Von Kurzgeschichten und Schreibwettbewerben hält er sich fern. Gerade Erstere hält er für „eine Todesfalle angehender Autoren“. Warum, das wäre selbsterklärend.
Versuchen sollte man es aber trotzdem
Meist gegen Ende unserer Gespräche fragte ich jeden Autoren, was er anderen, angehenden Schreibern raten würde. Sollte man sich, im Angesicht der furchtbaren Erfolgsquote, überhaupt noch daran versuchen, ein Schriftsteller zu werden? Die Antworten darauf waren meist desillusioniert und ernüchternd. Nur die Wenigsten empfahlen weiterhin eine Karriere im kreativen Schreiben.
Die besten und vielleicht weniger hoffnungszertrampelnden Ratschläge erhielt ich von Ben. „Wer Autor werden will, sollte damit rechnen, dass er keiner wird“ – sich keine großen Hoffnungen zu machen, empfiehlt er jedem als ein grundlegendes Mindset. Schreiben kann sehr Vieles sein: entspannend, erleichternd, erlösend. Man lebt sich aus; lernt, sich neu auszudrücken, lässt seinen Gedanken freien Lauf und entdeckt ganz neue Seiten an sich selbst, so dass es nur wenig verwunderlich ist, warum Psychotherapeuten zu Tagebüchern raten – Geld verdienen lässt sich damit jedoch nur selten. Schon jetzt ist der Buchmarkt mehr als gesättigt, „der Teich so voll, dass man drüber laufen kann“. Jeder neue Platz darin muss hart erkämpft werden. Wer also einen finden möchte, sollte sich auf Enttäuschungen vorbereiten und wer von sich selbst weiß, dass er damit nicht besonders gut umgehen kann, sollte es besser nicht versuchen. Ablehnung und Kritik können nämlich unerwartet heftig einschlagen, gerade in das sensible Wesen eines Kreativen. Ben erzählt mir von Autoren, die Zusammenbrüche und Depressionen erlitten, weil niemand ihre Werke haben wollte oder sie im Internet verrissen wurden. „Die Künstlerseele ist zu zart, die Künstlerszene zu hart“, dichtet er, ohne es als Scherz zu meinen. „Versuchen sollte man es aber trotzdem!“
Sein Tipp für alle angehenden Schreiber lautet, zwei, maximal drei Romane zu schreiben und diese an möglichst viele, kleine Verlage und Agenturen zu schicken. Wird der Dritte nicht genommen, soll es halt nicht sein. Prophezeit er und beginnt das nächste Kapitel seines 42. Romans, der vermutlich ebenso niemals in einem Bücherregal stehen wird.